Turin, 1943. Während Luftangriffe die Stadt erschüttern, flüchtet der Gymnasiallehrer Corrado sich in den Schutz der Berge. Mit dem Widerstand möchte er nichts zu tun haben, gleichzeitig plagen ihn deswegen Schuldgefühle. Cesare Paveses Roman Das Haus auf dem Hügel, 1967 im italienischen Original erschienen, wurde nun von Maja Pflug neu übersetzt. Das Buch stellt Fragen, die nach wie vor hochaktuell sind: jene nach der moralischen Verantwortung des Einzelnen und der Notwendigkeit politischen Engagements.
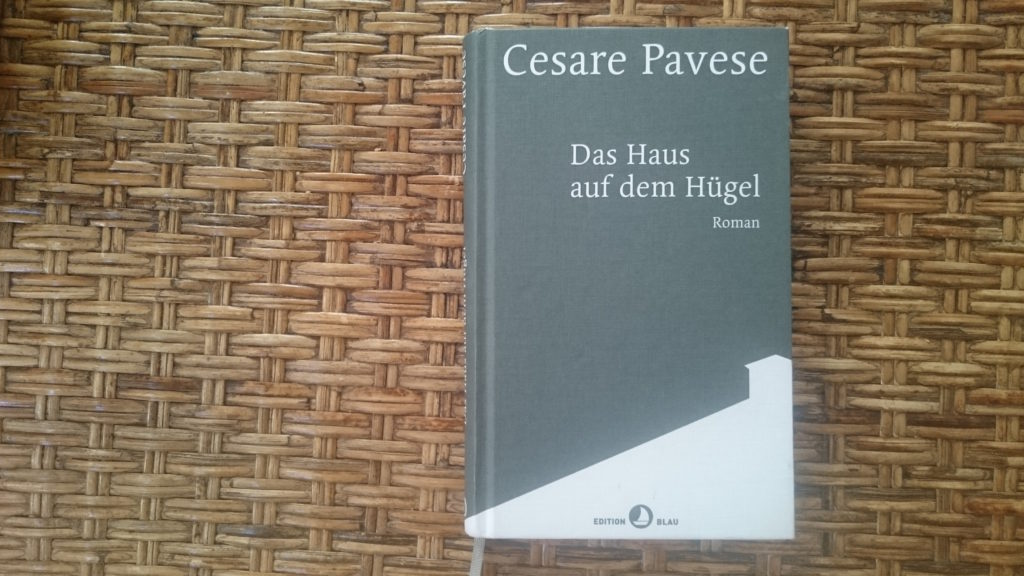
Fast könnte man meinen, es sei eine heile Welt, die Cesare Pavese in seinem neuübersetzten Roman Das Haus auf dem Hügel beschreibt: Im ersten Kapitel begleiten wir den Ich-Erzähler Corrado auf seinem Heimweg; von Turin aus den Berg hinauf, an Feldern, Mäuerchen und Wiesen vorbei bis zu der Villa, in der er bei einer Alten und ihrer Tochter ein Zimmer gemietet hat. Damit ist das zentrale Setting des Romans bereits abgesteckt: Es gibt die Stadt und es gibt den Hügel. An und zwischen diesen beiden Polen spielt sich das Leben Corrados ab. Tagsüber unterrichtet er als Gymnasiallehrer in Turin und kehrt allabendlich in das Haus auf dem Hügel zurück. In seiner freien Zeit unternimmt er ausgedehnte Streifzüge mit seinem Hund Belbo durch die umliegenden Wälder und hängt seinen Gedanken und Erinnerungen nach − an die Kindheit, frühe Jugendjahre und verflossene Liebschaften.
Was man angesichts der beschriebenen Idylle beinahe vergisst: Wir schreiben das Jahr 1943 und in ganz Europa tobt der Krieg. Auch Turin wird regelmäßig von nächtlichen Luftangriffen der Alliierten erschüttert. In der Gaststätte des Ortes Le Fontane diskutiert man heftig über die neuesten Geschehnisse. Corrado kehrt zwar oft dort ein, bleibt jedoch Beobachter und vermeidet es, in Diskussionen eine klare politische Position zu beziehen. Der Krieg scheint ihm in erster Linie eine willkommene Ablenkung von der Leere und Monotonie seines Alltags zu sein. Dennoch ist er letztlich immer wieder froh, in die „verkrochenen Wälder“ und die „laue Nestwärme“ des Hauses auf dem Hügel zurückzukehren. Von dort aus kann er das Kriegsgeschehen aus sicherer Entfernung betrachten: „Ich wusste, dass die Stadt in der Nacht in Flammen aufgehen und die Leute sterben konnten. Die Schluchten, die Landhäuser und die Wege würden am Morgen ruhig und unverändert erwachen. Am Fenster zum Obstgarten würde ich wieder den Morgen sehen.“
Somit fungiert der Hügel auch als Chiffre. Er steht für „eine Auffassung der Dinge“, für die zurückgezogene, inaktive „Lebensart“ des Erzählers. Gepaart mit dem Egoismus, den Corrado an den Tag legt, ist er keineswegs eine sympathische Figur. Er selbst gibt zu: „Ich fordere nicht Frieden für die Welt, sondern für mich.“ Wenngleich Corrado sich seiner Passivität schämt, ändert er nichts an seinem Verhalten; er spricht stattdessen von einem „Klassenschicksal“, das rechtfertige, dass er sich aus jeglichen Widerstandsbemühungen heraushalte. Die biographischen Parallelen zwischen Hauptfigur und Autor scheinen auf der Hand zu liegen: Cesare Pavese wurde am 9. September 1908 im Ort Santo Stefano Belbo geboren. Die Gegend ist im Roman nicht nur Hauptschauplatz, sondern auch Namensgeber von Corrados Hund Belbo. Im Gegensatz zu seinem direkten Umfeld engagierte Pavese sich nicht in der Partisanenbewegung. Während sein Autorenkollege und Freund Leone Ginsburg als Widerstandskämpfer starb, zog er sich aus den Gefahrenzonen zurück und suchte Unterschlupf in den Bergen sowie bei seiner Familie. Die Vermutung liegt nahe, dass der Autor sich mit dem Schreiben von Das Haus auf dem Hügel auch an seinen eigenen Schuldgefühlen abgearbeitet hat.
Stilistisch besticht Das Haus auf dem Hügel durch eine schmucklose Sprache, die nur vereinzelt von lyrischen Einsprengseln durchbrochen wird: Albträume etwa ziehen „wie räudige Hunde durch die Dorfgassen“. Verwirrung entsteht allerdings durch die bei direkter Rede und Gedankengängen gleichermaßen angeführten Anführungsstriche. Zudem wirken die Dialoge stellenweise sperrig. Der wechselhaften sprachlichen Qualität des Textes entsprechen die Auf und Abs des generellen Leseerlebnisses: Einem fesselnden Beginn, der durch seine präzise, geschliffene Sprache besticht, folgt ein langatmiger Mittelteil, in dem es vor Redundanzen und holprigen Dialogen nur so wimmelt. Möglicherweise wollte Pavese mittels dieser Schilderung des Immergleichen die Monotonie der Lebenswelt des Erzählers abbilden. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Geduld der Lesenden hier auf eine harte Probe gestellt wird. Ein Bruch geschieht erst wieder in den letzten Kapiteln. Fast scheint es, als habe Pavese hier selbst bemerkt, dass er der Handlung am Ende des Romans noch einmal ein wenig Leben einhauchen müsse, um den Text nicht in einem Sumpf ständiger Wiederholung veröden zu lassen. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Die Deutschen besetzen Turin, ein Großteil von Corrados Bekannten wird deportiert und auch er muss fliehen. Sein Ziel ist das Dorf seiner Kindheit. Da Corrado den Ort zuvor so gut wie nie erwähnt hat, erscheint es unglaubwürdig, dass dieser mit einem Mal als Sehnsuchtsort des Erzählers präsentiert wird.
Dennoch besitzt der Roman eine außergewöhnliche Kraft. Die Fragen nach der Notwendigkeit gesellschaftlichen Engagements, die er stellt, sind hochaktuell. Der Krieg ist während der Lektüre stets präsent. Man könnte ihn als eigene Figur bezeichnen, die sich im Laufe des Textes von einem Nebendarsteller zum heimlichen Protagonisten des Romans entwickelt. Spätestens bei der Ankunft in seinem Heimatdorf wird schließlich auch Corrado bewusst, dass er sich den Auswirkungen der Kämpfe nicht mehr entziehen kann: „Ich konnte es nicht glauben, dass auch diese Leute, die in meinem Blut und in meiner abgeschlossenen Erinnerung lebten, den Krieg, den Sturm, den Schrecken der Welt erlitten hatten. Es war unbegreiflich und unannehmbar für mich, dass das Feuer, die Politik, der Tod meine Vergangenheit verwüsteten.“ Was müssen es für Zeiten gewesen sein, fragt sich der Lesende, in denen selbst absolute Passivität, selbst ein Rückzug in seiner radikalsten Form nicht mehr möglich ist und in denen sogar einer wie Corrado, der vollkommen einsam und ohne jede Verantwortung für einen Zweiten lebt, es letztendlich nicht mehr schafft, seinen eng gesteckten Radius der persönlichen Sicherheit und des Unbeteiligtseins aufrechtzuerhalten. Der Roman gibt darauf eine Antwort und dies nicht – und das ist seine größte Leistung – indem er von Konkretem erzählt, sondern indem er die Unentrinnbarkeit des Krieges auf emotionaler Ebene spürbar werden lässt.
von Katharina Korbach
Diese Rezension entstand im Sommersemester 2018 im Rahmen des Seminars „Schreibende Leser“ an der Freien Universität Berlin.
Cesare Pavese, Das Haus auf dem Hügel, Rotpunktverlag, Edition Blau, 2018, aus dem Italienischen übers. von Maja Pflug, 216 Seiten, 24€.
- Über die Lücken der Erinnerung: Nadja Spiegelman – Was nie geschehen ist - 24. Februar 2019
- Hundebingo und georgische Leckereien: „Spreepartie“ geht in die dritte Runde - 6. September 2018
- Vom Schwinden der Nestwärme: Cesare Paveses „Das Haus auf dem Hügel“ - 29. Juli 2018