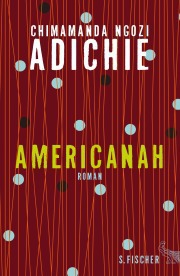
Schon zu Beginn des Romans wird klar: Ifemelu plant, die USA nach dreizehn Jahren wieder zu verlassen. Dabei war ihr amerikanisches Leben nach anfänglichen Schwierigkeiten durchaus von Erfolg geprägt. Sie war Stipendiatin der Princeton University und führte einen landesweit erfolgreichen Blog, auf dem sie ihre Erfahrungen und Überlegungen zum Schwarzsein in Amerika festhielt. Während sie sich beruflich also profilieren konnte, scheiterten ihre Versuche, Beziehungen zu führen jeweils nach einiger glücklicher Zeit. Schließlich zieht es sie nun zurück nach Nigeria, nicht zuletzt weil Obinze dort lebt. Kontakt haben die beiden seit einigen Jahren nicht mehr. Es waren seine Ermutigungen, die Ifemelu seinerzeit bewegten, die Reise nach Amerika anzutreten, doch konnte Obinze seinen Plan, ihr nach Abschluss des Studiums zu folgen, nicht Wahrheit werden lassen. Bis nach London war er vorgedrungen, als die wenig ausländerfreundliche Einwanderungspolitik der Europäischen Union zu seiner Abschiebung führte.
Die Dramaturgie trägt bis zum letzten Satz
Sein scheinbar erfüllendes Leben in Lagos mit Geld, Frau und Kind, das er aus der folgenden Resignation aufbaute, kann kaum über den Schmerz hinwegtäuschen, der noch immer in ihm erwacht, wenn Erinnerungen an die große Liebe zu Ifemelu in ihm aufkommen. Ihre Ankündigung, nach Nigeria zurückzukehren, und die möglichen Konsequenzen eines Wiedersehens tragen nicht nur Obinze, sondern auch die Spannung des Lesers bis zur letzten Seite des Romans.
Ganz gleich in welcher Episode des Romans wir uns befinden – sei es Ifemelus Rückblick auf die Kindheit, Obinzes Versuch einer Scheinheirat in London oder die Betrachtungen über amerikanische Verhaltensweisen – Chimamanda Ngozi Adichie schafft es jederzeit, den Leser ins Jetzt der Erzählung zu ziehen, immer nah an den Figuren zu sein. So schöpft Adichie in Americanah eine fiktive Wirklichkeit mit enormer Anziehungskraft.
Adichies Roman beweist in kleinsten Details größtes Weltverständnis.
Es ist jedoch nicht das Besondere, sondern das Gewöhnliche, das diesen Roman ausmacht. Zu keiner Zeit betont die Erzählerin Bedeutsamkeit oder Originalität von Ifemelus oder Obinzes Schicksal. Barack Obama als Projektionsfläche kollektiver Hoffnung ist als Topos genauso bekannt wie die Kompetenzen von Facebook, wenn es darum geht, sich zumindest visuelle Einblicke in das neue Leben verflossener Liebschaften zu verschaffen. Nein, es ist vielmehr der wohltuend unvertraute Blick auf längst bekannte Muster, der in den Schilderungen der Erzählerin besticht. Als Ifemelus Beziehung zu Blaine am Abend von Barack Obamas Wahlsieg scheitert, erklärt sie die Stagnation der Partnerschaft mit dem wirkmächtigen Bild, „dass die Beziehung mit ihm am besten mit einem Haus zu vergleichen war, mit dem sie zufrieden war, in dem sie jedoch immer am Fenster saß und hinausschaute.“ Gibt es Stereotypien, so etwa in den Schilderungen klassisch amerikanischer oder – in Obinzes Fall – britischer Verhaltensweisen, so werden diese entweder gleich wieder entkräftet, oder enthalten die nötige Ernsthaftigkeit, um nicht klischiert zu wirken.
„Versuch’s mal mit arm und nicht-weiß“
„In diesem Land kann man keinen ehrlichen Roman über Rasse schreiben. Wenn man darüber schreibt, welche Bedeutung Rasse wirklich für die Leute hat, dann ist es zu augenfällig“, sagt eine exzentrische, amerikanische Schwarze während eines Abendessens zu Ifemelu. Sie fährt fort: „Wenn du also über Rasse schreiben willst, dann sorg dafür, dass es lyrisch und feinsinnig ist, damit der Leser, der nicht zwischen den Zeilen liest, gar nicht merkt, dass es um Rasse geht.“ Wie aber schafft es Adichie, einen so klar von Hautfarbe und Rassengeschichte handelnden Roman zu schreiben, ohne fortwährend einen moralischen Zeigefinger zwischen Leser und Handlung schweben zu lassen? Der Kunstgriff ist hier die gelegentliche Integration von Ifemelus Blogeinträgen. Diese sind unverkennbar gesellschaftspolitische Beiträge, die in Klartext formulieren, was die Romanhandlung nur impliziert. „Was Akademiker unter weißen Privilegien verstehen, oder: Ja, es ist beschissen, arm und weiß zu sein, aber versuch’s mal mit arm und nicht-weiß“ ist einer dieser kraftvollen Einwürfe, die durch die bedachte Einbettung in den Erzählhintergrund unmissverständlich, aber nicht dogmatisch wirken. Es ist Ifemelus Stellung zwischen den Kulturen, die die erzählerischen Perspektivwechsel, vor allem aber den inneren Wandel der Figur ermöglichen. Einmal im Bewusstsein der Bedeutung ihrer Hautfarbe, begreift und benennt sie zusehends den Unterschied zwischen amerikanischen und nicht-amerikanischen Schwarzen.
Die Rasse als „kurioser Stein“
Immer wieder werden die ernsthaftesten Diskurse von Adichies feiner Sprache umhüllt, und gewinnen so beträchtlich an Wirkungskraft: „Es war nicht so, dass sie das Thema Rasse mieden, sie und Curt. Sie sprachen auf eine aalglatte Weise darüber, die nichts eingestand und zu nichts verpflichtete und mit dem Wort „verrückt“ endete, als wäre Rasse ein kurioser Stein, den man studierte und dann beiseitelegte.“ Americanah hingegen, dieses starke, wichtige Buch, lässt sich kaum beiseitelegen. Es verschafft Erkenntnisse und Perspektiven, die auch hiesigen gesellschaftlichen Debatten, zumal in europapolitisch abenteuerlichen Zeiten wie diesen, nur zuträglich sein können.
- Die Erkenntnis zwischen den Welten: Americanah - 2. Juni 2014
- Die Entsprechung einer Oase – Alexander Kluges Essay an die digitale Generation - 21. Januar 2014
- Eine Jugend in Metaphern - 12. November 2013