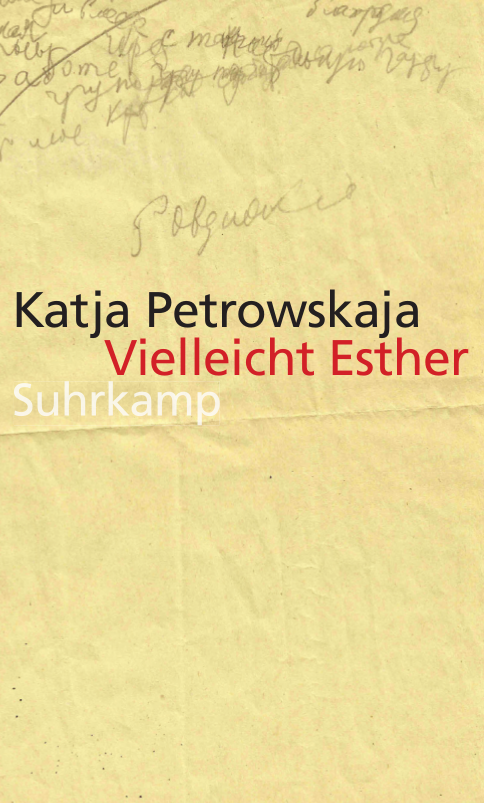Die Autorin Katja Petrowskaja spricht im Interview über die Angst vor dem Nichtverstandenwerden, ihre Faszination für Berlin und darüber, wie man zufällig den Bachmann-Preis gewinnt
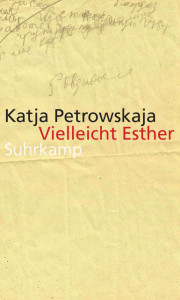
Von Theresa Schmidt
Frau Petrowskaja, Sie haben im letzten Jahr viele Interviews durchgestanden. Welche Fragen sollte man Ihnen lieber nicht stellen?
Katja Petrowskaja: Schwer zu sagen. Meistens waren diese Fragen für mich zu direkt oder zu intim. Ich habe in meinem Buch zwar über intime Sachen geschrieben, aber ich habe es oft als grob erlebt, wenn man zum Beispiel ganz konkret etwas zur Geschichte meiner Familie fragt. Andererseits wurden sehr wenige Fragen über die Sprache gestellt und was ich eigentlich sagen wollte.
Dann holen wir das jetzt nach und reden über Sprache. Sie haben ihr Debüt „Vielleicht Esther“ auf Deutsch geschrieben. Warum?
Das war eine Mischung aus Entscheidung und Zufall. Ich wollte etwas erzählen, Geschichten aus dem Leben, die emotional nicht konvertierbar sind, und ich glaube, dass ich die deutsche Sprache brauchte, um die Emotion zu konvertieren. Ich hatte tatsächlich viele Texte auf Russisch angefangen, aber sie wollten ins Deutsche, ich konnte nichts dagegen tun.
Wie äußert sich eine solche Konvertierung sprachlich? Ich stelle es mir schwer vor, nicht in der eigenen Muttersprache zu schreiben…
Es war sehr schwer, viel schwieriger als auf Russisch. Bei mir entwickelten sich Gedanken um die deutsche Sprache herum. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, an der ich am Kopiergerät stehe und Akten kopiere. Und irgendwann verstehe ich, dass ich diese Blätter kopiere, weil es um Rettung geht, Gerät und Rettung. Aber das reimt sich eben nur bei mir und es gab viele solcher Dinge. Auch die Sache mit nemetz und stumm: Ich schreibe auf Deutsch und im Russischen ist nemetz der Stumme, also nemoi. In einer ‚stummen’ Sprache schreiben, was passiert da eigentlich?
Hatten Sie Angst, dass Ihr assoziatives Schreiben falsch oder gar nicht verstanden wird?
Ich habe immer Angst. Deswegen ist Angst oft gar nicht wichtig.
Angst wovor?
Man sitzt mehrere Jahre allein und schreibt. Natürlich hat man da Angst, ob man verstanden wird. Ich dachte am Anfang auch, dass es absurd ist, die sowjetisch-jüdische Geschichte auf Deutsch zu schreiben, aber etwas in mir war sich sicher und irgendwann hatte ich mehr Arbeit als Angst.
Zumal Deutsch lernen schon Arbeit genug ist …
Eigentlich habe ich erst durch das Buch Deutsch gelernt. (lacht) Kann sein, dass ich diese Geschichte nur auf Deutsch schreiben konnte, weil es einen Abstand zu den Leiden meiner Familie und diesen schrecklichen Geschichten herstellt. Aber es ist für mich auch eine Liebesgeschichte, zur Sprache und zu diesem Raum.
Welchen Raum meinen Sie damit?
Ich bin mit 29 ganz bewusst nach Berlin gezogen. Ich war vorher schon ein paarmal da und wollte einfach hierhin. Hier habe ich viele Sachen verstanden, auch, was den zweiten Weltkrieg angeht. Mit sechzehn oder siebzehn hatte ich den Film „Der Himmel über Berlin“ von Wim Wenders gesehen. Zehn Jahre später stand ich auf dem Potsdamer Platz und es sah genauso aus wie in diesem Film. Und ich konnte nicht glauben, dass diese Stadt so zerbombt war und dass die Kriegsflächenflächen gewissermaßen von einer Mauer konserviert wurden. Und da verstand ich, dass es eine verletzte Stadt ist. Es geht nicht darum, wer Recht hatte, wer angefangen hat und wer Schuld trägt, sondern einfach um diese Stadt.
Imré Kertesz schreibt in seinem Buch „Kaddisch für ein nicht geborenes Kind“ über den Redezwang als artikuliertes Schweigen. Das ist ein Gedanke, der auch zur ‚Sprache der Stummen’ passt. Haben Sie das Gefühl, im Schreiben über den Krieg schweigen zu können?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es gibt so etwas. Ich habe das Buch in gewisser Weise auch gegen dieses automatisierte Denken und den Umgang mit Zahlen und Wörtern geschrieben. Es hat mich immer wahnsinnig gemacht, wenn die Leute in Gesprächen oder Büchern einfach ‚Ausschwitz’, ‚Holocaust’ und ‚sechs Millionen’ sagen. Ich habe beim Schreiben erst verstanden, dass die Betrachtung von Grausamkeiten fast pornografisch ist: Wir gehen in die KZ und reden über die Opfer, als wären wir dort eingeladen. Ich habe versucht, anders darüber zu reden, jungfräulich, wenn man so will. Und diese Art von Reden hat viel damit zu tun, dass man darüber nicht reden kann.
Sehen Sie sich als Autorin in einer bestimmten Funktion?
Ich habe kein historisches Buch geschrieben, es interessiert mich nicht, was der Leser weiß, und was er nicht weiß, ich bewege mich zwischen zwei Diskursen. In einem Kapitel kommt zum Beispiel Janusz Korczak vor und mir wurde gesagt: „Kein Mensch in Deutschland kennt Janusz Korczak.“ Aber ich denke, dass die Leute, wenn sie googeln, wie man mit der BVG irgendwohin kommt, auch Janusz Korczak googeln können. Ich habe auch sehr viel gegoogelt. Also nein, ich habe keine Aufgabe. Ich werde von Sachen getrieben, die ich wichtig finde, aber es ist nicht so, dass ich das aus pädagogischen Gründen mache.
Sie schreiben einerseits über Ihre Familie, andererseits eröffnen Sie ein ganzes Panorama auf die Schmerzpunkte des 20. Jahrhunderts, eine Verbindung, die sich auch in der Struktur Ihres Buches spiegelt: Wir haben es größtenteils mit in sich abgeschlossenen Geschichten zu tun. War das von Anfang an klar?
Es sind tatsächlich unverbundene Geschichten, aber der Plan war ganz anders. Ich dachte, ich würde Novellen über verschiedene Familienmitglieder schreiben und darum eine Art Vignetten legen, wie man recherchiert hat, wohin man reist und so weiter. Dann haben aber diese Vignetten den ganzen Raum erobert und nun gibt es publizistische Texte, in einigen Kapiteln ist es eine Reise, andere Kapitel kreisen um eine Person oder ein Thema.
Ist Ihre Recherche nun abgeschlossen oder wird Sie das Thema weiter begleiten?
Ich wollte einfach ein Buch über die Vergangenheit meiner Familie schreiben. Ich habe einige Reisen unternommen und einige nicht, war in unzähligen Archiven und es gibt noch immer Sachen, die man tun kann. Ich habe einiges auch bewusst nicht gemacht. Ich bin kein Historiker und ich weiß, dass man zu jedem Thema ewig recherchieren kann. Das ist schön, aber es ist auch eine Gefahr. In gewisser Weise habe ich das beendet, aber ich habe es nicht abgeschlossen. Ich wollte mit diesem Buch Ruhe finden. Aber ich glaube, es ist eine Illusion.
Was bedeuten Ihnen Auszeichnungen wie der Bachmann-Preis, hätten Sie damit gerechnet?
Es war reiner Zufall, dass ich am Bachmann-Preis teilgenommen habe. Ich habe nie zu den Menschen gehört, die bei Wettbewerben mitmachen. Mit einer Freundin habe ich Texte vergeschickt. Ich habe noch gesagt: „Wenn ich gewinne, dann ist die deutsche Literatur im Eimer.“ Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so eine Reaktion auf das Buch geben wird! Einerseits bin ich sehr glücklich und kann das alles nicht fassen. Andererseits ist das eine enorme Entfremdung und eine Lautstärke, die schwer auszuhalten ist. Ich habe ein intimes Buch geschrieben, ein sehr leises Buch. Und dann sitzt du plötzlich in einem Saal, in dem 400 Menschen sind, und redest über Sachen, über die man eigentlich nicht reden kann.
Können Sie sich vorstellen, jetzt etwas ganz anderes zu schreiben?
Einen epochalen Liebesroman auf broken English! (lacht) Aber vielleicht kann ich „reine Fiktion“ auch gar nicht schreiben.
Katja Petrowskaja. Vielleicht Esther. Suhrkamp 2014. 19,95 Euro.
Das Interview entstand bei einem Besuch der Autorin im Rahmen des Seminars „Schreibende Leser“ des Masterstudiengangs der Angewandten Literaturwissenschaft.
Am 5. September (20 Uhr) ist Katja Petrowskaja, zusammen mit Isabelle Lehn, beim Literatursalon am Kollwitzplatz zu Gast. Zum Facebook-Veranstaltungshinweis geht es hier.
- Aktuelle Stimmen aus Norwegen – was dürfen wir vom Gastland der Leipziger Buchmesse 2025 erwarten? - 29. März 2025
- Der Sommer ist noch nicht vorbei: Bücher für den Seetag - 12. August 2024
- „Taylor Swift geht nicht ohne Swifties“ - 17. Juli 2024