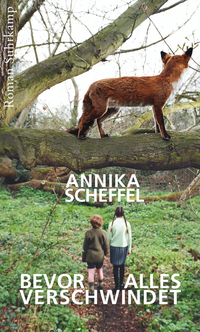Wer kennt das nicht: Ein Buch und unzählig viele Meinungen dazu. Gute Bücher regen zur Diskussion an, da jeder Leser und jede Leserin etwas anderes in ihnen sieht und liest. Besonders deutlich wird das, wenn man Rezensionen zu Büchern verfassen muss, denn hier muss man eindeutig Stellung beziehen und kann sich keine Unklarheiten in der Beurteilung erlauben. Wie unterschiedlich die Sichtweise auf ein und dasselbe Buch ausfallen kann, wollen wir hier im direkten Vergleich zeigen. Eleonora Pauli (Meinung Nr. 1) und Anna Seibt über Annika Scheffels zweiten Roman Bevor alles verschwindet (Suhrkamp, Februar 2013).

Von der Schwierigkeit zu handeln
Ein namenloser Ort, in einer Talsenke gelegen: Ein Bäcker, ein Gasthof, ein Gemischtwarenladen, ein Rathaus, und das war’s. Annika Scheffel verlegt das Geschehen ihres neusten Romans Bevor alles verschwindet ins Niemandsland. So wenig, wie sich die Bewohner des Ortes für die Außenwelt interessieren, so wenig interessiert sich im Gegenzug der Rest der Welt für sie. Als jedoch die „Gelbhelme“ anrücken, um das abgelegene Nest zu fluten und die Talsenke in einen Badesee zu verwandeln, kommt Bewegung in den eingespielten Dorfalltag. Die meisten Bewohner beugen sich ihrem Schicksal, verlassen den Ort und ziehen in ein extra für sie gebautes Ersatzdorf.
Einige wenige jedoch weigern sich, den vom Untergang bedrohten Ort zu verlassen. Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch zu handeln und dem Gefühl der Machtlosigkeit, versuchen sie, den drohenden Untergang auszublenden. Erstaunlich unbeteiligt wird geschildert, wie zehn der Bewohner das letzte halbe Jahr in dem Dorf verbringen, das nach und nach dem Erdboden gleich gemacht wird: „Stoisch wandert Wacho durch den Wolkenbruch und über den Hauptplatz, schiebt die Gedanken vom Untergang so gut es geht beiseite.“
Wacho heißt eigentlich Martin Wacholder, ist Bürgermeister des Ortes, Alkoholiker und notorischer Realitätsverdränger. Seit zwanzig Jahren wartet er auf die Rückkehr seiner Frau Anna, die es irgendwann nicht mehr in der erstickenden Enge des Ortes ausgehalten hatte. Aus Angst davor, noch einmal verlassen zu werden, tyrannisiert er seinen Sohn David. Der ist schon fast dreißig, lebt aber immer noch bei seinem Vater, und obwohl dieser seinen Sohn ständig quält und auch vor Schlägen nicht zurückschreckt, schafft es David nicht, sich von ihm zu lösen. So wie das Dorf Haus für Haus abgerissen und von den Gelbhelmen dem Erdboden gleich gemacht wird, so droht sich auch David mehr und mehr aufzulösen. Mit dieser Parallelführung beschreibt Scheffel, wie eng das persönliche Schicksal der Bewohner mit dem des Ortes verknüpft ist. Anfangs arbeitet David noch als Kellner im Gasthof. Nachdem jedoch auch dieser abgerissen wurde, erfindet sich David einen Freund namens Milo. Mit Milos Hilfe flüchtet er in Welten, die seinem Vater nicht zugänglich sind und erkämpft sich dadurch für kurze Zeit Autonomie. Schließlich hat Wacho seinen Sohn aber soweit, dass dieser sein Zimmer gar nicht mehr verlässt und dort mit gebrochenem Arm vor sich hin vegetiert.
Was für David in extremster Form gilt, trifft auch auf die restlichen Dorfbewohner zu: „Wenn man sie so am Tisch sitzen sehen würde, als Außenstehender, dann könnte man sie für Gespenster halten. Sie leben in einer Zwischenwelt, niemand protestiert noch ernsthaft.“ Die Bewohner des Ortes leben nicht miteinander, sondern nebeneinander her. Stur verharren sie in ihren Häusern, bis diese ihnen buchstäblich auf die Köpfe zu fallen drohen. Robert, der Dorfschauspieler, arbeitet ein halbes Jahr an einem Proteststück, das am Tag vor der Flutung aufgeführt werden soll. Als es endlich soweit ist, schafft er es jedoch nicht einmal, seinen Text zu Ende zu sprechen und flüchtet vor aller Augen von der Bühne. Auch diese Situation ist beispielhaft für das Denken und Handeln der Dorfbewohner, denen es nicht gelingt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, um das, was ihnen wichtig ist, zu verteidigen und zu bewahren. Sie sehen sich als Spielball einer höheren Macht und merken nicht, dass sie diese Macht durch ihre Apathie erst selbst erschaffen.
In ihrem zweiten Roman zeichnet Annika Scheffel das Bild einer Gesellschaft, die zwar einiges Potential zur Veränderung ihrer eigenen Welt hätte, dieses jedoch nicht nutzt. Der unverstellte Blick auf die Figuren und das Beziehungsgeflecht zwischen ihnen ist die große Stärke des Romans. Scheffel gelingt es eine Unmittelbarkeit zwischen Leser und Figuren herzustellen, die aber nicht zu einer Identifikation des Lesers mit dem Erzählten führt. Zum einen wird konsequent im Präsens erzählt, was die Figuren zwar ihrer Vergangenheit beraubt, jedoch ihre Ignoranz gegenüber der Zukunft ausdrückt. Zum anderen rückt in jedem Kapitel ein anderer Dorfbewohner in den Mittelpunkt, sodass man jeweils nur Ausschnitte der individuellen Schicksale erfährt. Scheffel beweist viel Feingefühl für die Psyche ihrer Figuren und findet Bilder für die Wünsche und Hoffnungen jedes einzelnen, wie beispielsweise den Geisterjungen Milo, den nach und nach auch die anderen Dorfbewohner sehen und der für jeden eine andere Sehnsucht verkörpert.
Was von der Lektüre dieses klaustrophobisch wirkenden Gesellschaftsromans bleibt, ist das unheimliche Gefühl, Zeuge einer geisterhaft sinnentleerten Gesellschaft geworden zu sein, deren Mitglieder mehr in ihrer eigenen Fantasiewelt leben als in der gemeinsam geteilten Realität.
von Anna Seibt
Die Meinung Nr. 1 von Eleonora findet Ihr hier.
- Readings are so boring right? - 8. Juli 2014
- Ein Buch, zwei Meinungen – Meinung Nr. 1 - 18. November 2013
- Ein Buch, zwei Meinungen – Meinung Nr. 2 - 18. November 2013